Freie Rede in geschützten Räumen – Handlungsfähigkeit der Hochschule im Umgang mit Diskriminierung
Ein Gespräch zwischen HKB-Direktor Thomas Beck, Annie Rüfenacht, Dozierende Sound Arts und Eliane Gerber, Forschende HKB
AR: Ich bin Lehrbeauftragte im Studiengang Sound Arts. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Diskriminierung ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich empfinde als Lehrperson eine gewisse persönliche Verantwortung gegenüber unseren Studierenden und lerne laufend selbst dazu. Dass ich sensibilisieren kann, dass ich sensibilisiert bin, dass ich empowere, ist für mich wichtig, nicht nur privat, sondern auch in meiner Lehre.
TB: Ich bin seit 2009 Direktor der Hochschule der Künste. In diesen 13 Jahren hat die HKB eine riesige Entwicklung durchgemacht. Ich würde sehr gern das Stichwort der Verantwortung gegenüber den Studierenden aufnehmen, denn ich wäre auf der falschen Position, wenn das nicht ein Hauptantrieb für meine Tätigkeit wäre. Die Hochschule als geschützten Raum zu verstehen: ja und nein. Ja, weil ich finde, wir brauchen eine gut verankerte Fehlerkultur, ich halte das für zentral. Ohne die Freiheit, scheitern zu dürfen, könnten wir unseren Auftrag nicht erfüllen. Studierende, die sich künstlerisch oder gestalterisch artikulieren, müssen in der Lage sein, Erfahrungen zu sammeln, ohne gleich der grossen Öffentlichkeit ausgesetzt zu sein. Sie müssen den Expert*innen gegenüber ihre Entwicklung präsentieren – im Dialog, im Mentorat und in welchem Format auch immer. Ich glaube, es ist essenziell, dass dies nicht in der breiten Öffentlichkeit passiert, sondern im geschützten Raum. Dennoch kann und möchte ich die Studierenden der HKB nicht beschützen vor all den Diskursen und Dialogen, und seien sie auch noch so angriffig, denen sie vielleicht im späteren Berufsleben ausgesetzt sein werden. Ich glaube, es gehört vielmehr zu unserer Ausbildung, den angehenden Künstler*innen den Umgang damit zu erleichtern und sie darauf vorzubereiten. Insofern muss der geschützte Raum auch viele Fenster zur Welt haben.
EG: Ich habe 2020 an der HKB den Master of Design abgeschlossen. Ich bin im Forschungsschwerpunkt Design und Rhetorik sowie in der Projektleitungsgruppe Antidiskriminierung tätig und beschäftige mich auch in meiner Freizeit und sonst im Beruf mit Fragen rund um Gewalt und Diskriminierung und damit, wie man Gewalt vermeiden oder dagegen auftreten kann. Unter dem Begriff Safe Space verstehe ich einen Ort, an dem Leute mit ähnlichen Erfahrungen untereinander sind, wodurch ein Gefühl von Sicherheit entsteht. Mir ist es wichtig, dass eine Hochschule wie die HKB ein vielfältiger Raum ist. Aus meiner Sicht kann die HKB kein Safe Space sein, weil wir Vielfalt wollen und ein Ort sein wollen, wo Leute in Vielfalt aufeinandertreffen. Zudem ist die Frage der Sicherheit – und wen wir vor was schützen – auch eine Frage in Bezug auf die Zugänglichkeit der Hochschule. Wie stellen wir sicher, dass viele verschiedene Menschen an der Hochschule sein können? Daher finde ich wichtig, dass die Hochschule im Umgang mit Diskriminierung handlungsfähig ist und für mehr Sicherheit sorgt, als sie in einer Gesellschaft vorhanden ist, die stark geprägt ist von Rassismus, Sexismus und ganz vielen anderen Formen von Diskriminierung.
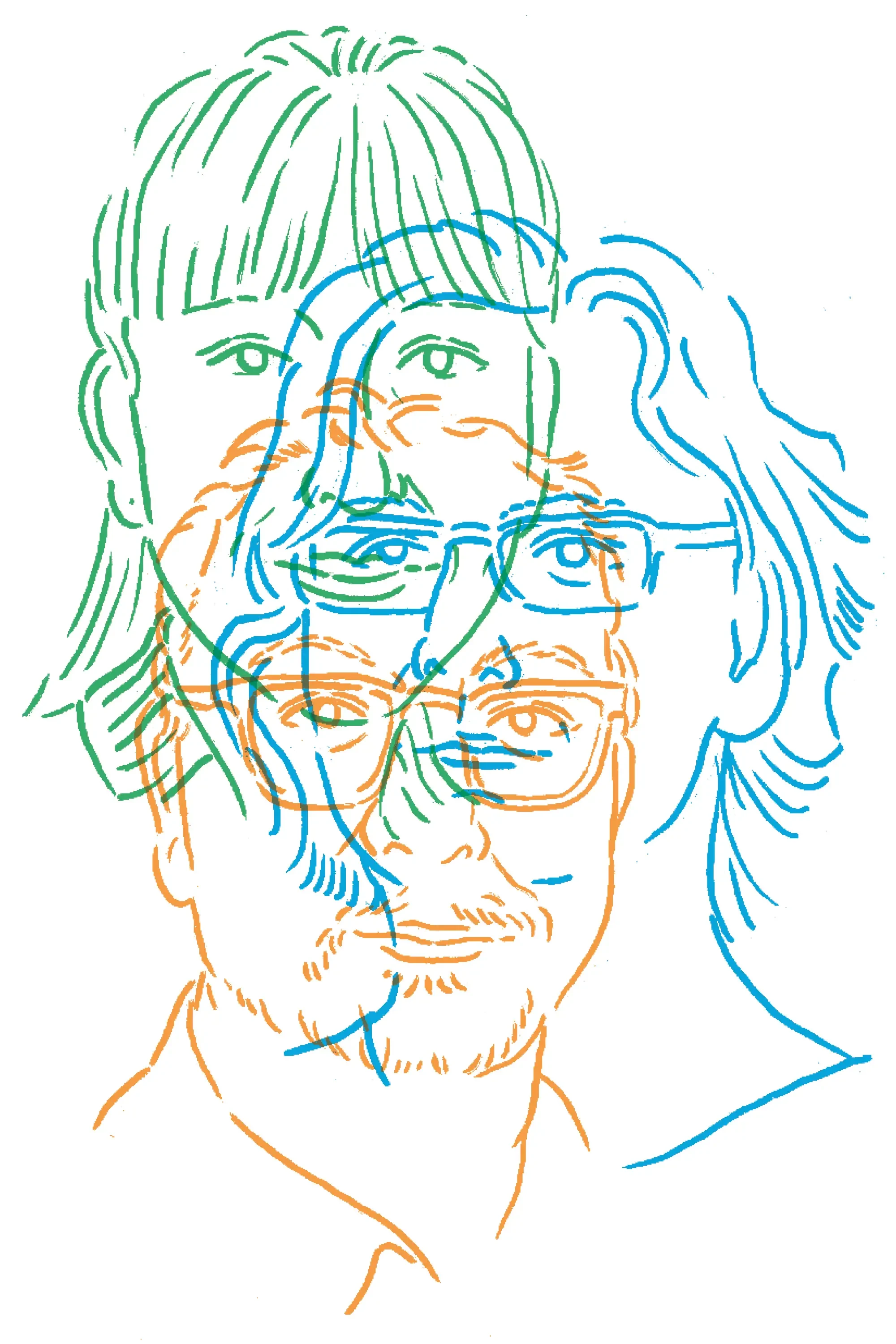
TB: Wie siehst du das Verhältnis von Sicherheit und Diversität?
EG: Ich habe selber eine Traumafolgestörung. Damit ich an Kursen zu gewissen Themen teilnehmen kann, ist es für mich wichtig, dass ich vorab informiert bin und meine Zustimmung geben kann, wenn im Kurs zum Beispiel stark gewalttätige Bilder gezeigt werden. Denn wenn ich darüber nicht informiert bin und mit solchen Bildern unvorbereitet konfrontiert werde, löst das bei mir unter Umständen eine Panikattacke aus. Dieses Beispiel zeigt, dass die Hochschule meinen Zugang mindert, wenn ich nicht die Möglichkeit erhalte, mich zu schützen, sondern mir einfach alle möglichen Inhalte zugemutet werden. Diese Diskussion führen wir im Projektleitungsteam auch immer wieder. Sie ist im Zusammenhang mit Unterricht, Kanon und studentischen Projekten an einer Kunsthochschule von grosser Bedeutung. Gibt es Themen, Bilder und Ausdrücke, über die vorab informiert werden sollte, wenn sie vorkommen? Wer wird ausgeschlossen, wenn alles jederzeit sag- und zeigbar ist? Und wann sind Grenzüberschreitungen in künstlerischer Arbeit produktiv, relevant und wichtig? Und welche Rahmenbedingungen eignen sich dazu, dass angehende Kunstschaffende dazu eine differenzierte, eigene Haltung entwickeln können? Ich glaube, es braucht – zumindest situativ – Grenzen. Diese verändern sich auch mit dem gesellschaftlichen Diskurs.
TB: Ich finde das aus deiner Perspektive absolut nachvollziehbar. Ich glaube einfach, dass die Grenze zu Zensur und Selbstzensur eine sehr schmale ist. Diese Linie so virtuos zu bespielen, dass sie das künstlerische Potenzial nicht willkürlich einschränkt, ist eine grosse Herausforderung. Eine Kunstgeschichte ohne Gewaltdarstellung ist nicht vorstellbar. Habe ich dich richtig verstanden, dass du sagst, das muss auch möglich sein, aber bitte gebt mir vorher Bescheid, damit ich mich aus einem solchen Diskurs ausklinken kann?
EG: Genau. Oft beobachte ich eine Polarisierung: «Darf man das noch sagen?». Entweder jede*r darf jederzeit oder niemand niemals. Aber die Beschäftigung mit der Frage, ob man für unterschiedliche Leute unterschiedliche Räume schaffen sollte, fehlt. Oder auch die Frage, wie Leute ihre Zustimmung geben können oder wie sie darüber informiert werden können, damit sie selber entscheiden können, ob sie damit konfrontiert werden wollen oder nicht.
TB: Ich gebe zu, die Vorstellung, dass ein Filter darübergelegt wird, wer welche Kunst konsumiert, ist für mich im Moment eher abschreckend. Heute schon kannst du den Kinosaal jederzeit verlassen, auch wenn du nicht vorgewarnt wurdest. Du kannst sagen, dem setze ich mich nicht aus, ich gehe. Führen Triggerwarnungen nicht automatisch auch zu einer Selbstzensur von Künstler*innen? Ist es erstrebenswert, dass ein Teil des Publikums nur noch die eine Form von Kunstwerken und ein anderer Teil des Publikums eine andere Form von Kunstwerken zu sehen oder zu hören bekommt, wenn wir uns daran gewöhnen, dass jede künstlerische Äusserung im Vorfeld mit Filtern versehen ist? Unterbindet das nicht einen gemeinsamen Reflexionsprozess? Wäre es nicht viel interessanter, wenn verschiedenste Leute mit und ohne Traumatisierungen, mit verschiedensten Hintergründen – einfach ein maximal diverses Publikum – über Gewalterfahrungen ins Gespräch kämen? Verhindert man eine diskursive Wahrnehmung von Kunst nicht dadurch, dass man sie so separiert?
AR: Es wird immer Diskriminierung stattfinden, solange wir ein Publikum im Raum haben, das sich nicht mit dieser Thematik auseinandersetzt. Anders gesagt es wird immer eine latente Diskriminierungsgefahr bestehen, solange wir Studierende ausbilden, die diesen Diskurs im Prozess ihrer künstlerischen Arbeit nicht reflektieren. Dass wir als Lehrpersonen wissen, wie wir sie während ihres Studiums begleiten können, damit eine bewusste Auseinandersetzung zum Beispiel mit Sprache stattfindet oder der Diskurs zur Diskriminierung in der eigenen Kunst- oder Musikvermittlung überhaupt in Betracht gezogen wird, finde ich wichtig. Ich wünsche mir ein diverses Publikum, darum ist es für mich erstrebenswert unsere Studierende zu informieren, ihnen ein Bewusstsein zu verschaffen, was Diskriminierung überhaupt ist, sie zu erkennen und zu benennen, um schlussendlich auch Gewalt- oder Rassismuskontexte in der Kunst hinterfragen zu können.
EG: Jetzt ist die Situation so, dass auf dem Papier alle Zugang haben. Aber nicht jeder Raum ist für jede Person im gleichen Mass sicher. Menschen sind divers, deshalb sind wir – auch wenn es auf dem Papier anders aussieht immer in Situationen, wo unterschiedlich guter Zugang besteht. Wie kann die HKB ihre Veranstaltungen so sicher gestalten, sodass alle an ihnen teilhaben können, und wo ist die Schwelle für verschiedene Leute? Und welcher Raum braucht welche Grenzen? Auch in unserer Hochschule gibt es verschiedene Räume. Es gibt Räume, wo wir über ein Diskriminierungsthema sprechen. Es gibt Räume, wo wir in der Klasse sind und vielleicht über ein Buch oder einen Text sprechen, der sich mit einem Diskriminierungsthema befasst. Wo wir Kunst produzieren, das ist noch einmal ein anderer Raum. Ich glaube, diese Räume haben unterschiedliche Ansprüche an Sicherheit und brauchen unterschiedliche Grenzen. Ich weiss aber nicht, ob Sicherheit der richtige Ausdruck ist oder ob es nicht eher um die Frage des Zugangs geht. An Orten, wo ich mich nicht sicher fühle, nehme ich weniger aktiv teil.
TB: Was verstehst du in diesem Kontext unter Sicherheit?
EG: Es kommt auf meine Position an. Wenn ich als Mitarbeitende weiss, dass ich riskiere, meinen Job zu verlieren, wenn ich irgendetwas über mich erzähle, führt das zu einer Form von Unsicherheit. Wenn Leute mich auf eine beleidigende Art und Weise beschimpfen und sich niemand dagegen wehrt, führt auch das zu einer Form von Unsicherheit. Auch wenn ich etwas sage und völlig falsch verstanden werde, kann das zu einer Form von Unsicherheit führen. Wie seht ihr das mit der Sicherheit in Bezug auf einen Hochschulkontext?
AR: Während meiner Zeit als Studentin an der HKB gab es Situationen, in denen ich merkte, das macht irgendetwas mit mir. Da hätte ich mir gewünscht, mehr Unterstützung, Vertrauenspersonen oder Gleichgesinnte zu haben. Dort sehe ich auch, dass sich die HKB in den letzten zehn Jahren sehr weiterentwickelt hat, schon nur bezüglich der Sensibilisierung. Dass die HKB sich hier entwickelt, sich verändert hat und auch die Dringlichkeit sieht, finde ich positiv. Grosse Unsicherheiten sehe ich im Moment darin, wie wir unsere Studierenden abholen können, wenn sie eine negative Situation erleben. In solchen Situationen müssten wir die Studierenden besser unterstützen.
TB: Das Schlüsselwort ist «Sensibilisierung». Was aus meiner Sicht nicht der Weg sein kann, wäre Separation. Nur noch Leute zusammen zu bringen mit ähnlichen Hintergründen und diese möglichst von den anderen zu separieren, damit sie nicht in Konflikt zueinander geraten, sehe ich als grundfalschen Weg. Ich befürchte, wenn man diese Strategie einschlagen würde, führte das mindestens mittelfristig zu noch viel mehr Diskriminierung, weil es die Vorurteile der einzelnen Blasen anheizen würde. Dadurch würde ein produktiver Diskurs verunmöglicht.
EG: Ich sehe es als Hauptaufgabe für uns alle, zu üben, mit Diversität umzugehen, so dass ein angemessener Zugang für alle resultiert. Damit wir in der Lage sind, aufeinander einzugehen, zusammenzuarbeiten und unsere Probleme zu lösen, braucht es Begegnungen in dieser Vielfalt. An gewissen Orten braucht es Safe Spaces, wo Leute, die ähnlich sind, sich über ihre Erfahrungen austauschen können. Ob die HKB diese bereitstellen muss, ist eine andere Frage. Die Hauptaufgabe der HKB ist, ein Ort zu sein, wo möglichst viele verschiedene Menschen zusammenkommen können, und dafür braucht es gewisse Grundlagen. Wir stellen fest, dass gewisse Gruppen an der HKB fehlen. Wir müssen hinterfragen, ob es für sie vielleicht Hürden beim Zugang gibt. Wir sollten uns konstruktiv damit auseinandersetzen, wo wir Hürden in unserem Umgang schaffen und wie wir diese abbauen können.
TB: An Kunsthochschulen sind wir alle Mitglieder einer Gated Community. Da sind schon schwere Eisentore vor unseren Institutionen, das ist uns auch sehr bewusst. Wir haben eine Initiative gestartet, stehen hier aber noch ganz am Anfang, eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Felicity Lunn, in der es darum geht, die Diversität unter den Studierenden zu erhöhen. Das bedeutet vor allem, dass man sich diese Eisentore vor den Kunsthochschulen genauer anschauen und sehen muss, wer einen Schlüssel zu diesen Toren hat, wie mit diesem Schlüssel umgegangen wird und wer eigentlich überhaupt in der Lage ist, die «geheiligten Hallen» einer Kunsthochschule betreten zu können. Oft ist das nur bedingt abhängig von künstlerischem oder gestalterischem Potenzial, sondern es hat sehr viel mit Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen und vor allem mit sozialen Schichten zu tun. Diesem Thema werden wir uns annehmen, wobei wir hier vor allem auch die ganzen Eignungsprüfungsprozesse anschauen werden. Was für eine Sprache wird da gesprochen, wie muss man sich dort präsentieren können, um überhaupt in unsere Community Einlass zu finden? Da gibt es sehr viele Punkte, die wir vielleicht auch verbessern können.
EG: Das muss auf allen Ebenen passieren. Gleichzeitig, denke ich, sind wir in vielen Punkten schon an einem sehr guten Ort. Meine Erfahrung ist, dass an der HKB sehr konstruktiv darauf eingegangen wird, wenn ich meine Bedürfnisse kommuniziere.
AR: Das wollte ich mit meiner Aussage unterstreichen, dass sich sehr viel verändert hat. Das SkillsHub bietet interessante Weiterbildungsangebote und Workshops zu den Themen Diversity oder Antirassismus. Ich habe ein paar solche Kurse besucht und fand es super und lehrreich, weil auch ein Austausch stattfinden konnte. Ich wünsche mir, dass ein Austausch im Hochschulkontext noch weiter kultiviert und etabliert wird. Manchmal vielleicht mit noch etwas mehr Nachdruck auf die Tragweite, die eine solche Weiterbildung haben kann. Die HKB bildet Personen aus, die später im Berufsleben vielleicht in einer Führungsposition sind. Dort könnte sich die Hochschule der Dringlichkeit bewusster werden, dass nicht nur Studierende, Dozierende, Assistierende, Forschende, sondern auch Führungskräfte und Gremien, welche zum Beispiel über die Besetzung der Studienplätze entscheiden, an einem solchen Kompetenztraining teilnehmen. So konnte ich im Kurs neue Erkenntnisse gewinnen und auch im privaten Bereich meine Vorurteile und meine Privilegien hinterfragen. Ich würde mir wünschen, dass wir das alle gleichermassen erkennen.
TB: «Alle» wäre wohl eine Utopie. Aber wie erreichen wir möglichst viele? Ein bestimmter, zum Glück wachsender Personenkreis interessiert sich bereits dafür, den erreichen wir, der besucht diese Kurse und Workshops. Andere, die das Thema vielleicht weniger interessiert, halten sich davon eher fern. Das ist die grosse Schwierigkeit und dahinter steht natürlich auch die Frage, wie verpflichtend solche Weiterbildungen sein sollen. Und ist es überhaupt sinnvoll, jemanden gegen seinen Willen dazu zu verpflichten, so einen Kurs zu besuchen?
EG: Ein wichtiger Teil in den Weiterbildungen sind die Inhalte, die vermittelt werden. Gleichzeitig sind Weiterbildungen auch Orte, wo Menschen sich treffen und austauschen, Verbindung und Networking stattfinden können, woraus unter Umständen auch hochschulpolitische Aktionen entstehen können. Dort sehe ich eine grosse Chance. Hier stellt sich aber auch die Frage, ob wir Workshops anbieten, die jeweils auf eine bestimmte Form von Diskriminierung eingehen, oder solche, die eher Übergreifendes behandeln. Bei vielen Diskriminierungsthemen gibt es ähnliche Aspekte, die auf die verschiedenen Gruppen übertragbar sind, dann gibt es aber auch sehr viele gruppenspezifische Sachen. Vielleicht wäre es zukünftig auch sinnvoll, zumindest bei Mitarbeitenden für ein gewisses Grundwissen zu sorgen. Bei den Weiterbildungen sehe ich verschiedene mögliche Wege. HKB-weit ist aber auch die Rekrutierung wichtig und die Etablierung von Prozessen. Wir merken von der Projektleitung her, dass ganz viel Unterstützung kommt, spezifisch auch von dir, Thomas. Es ist Verständnis da, es ist Interesse da und du priorisierst die Themen. Ich möchte gern fragen, warum dir das so wichtig ist.
TB: Eine Hochschule ist ein extrem diverser Raum. Mit dieser hohen Diversität unserer Strukturen, Meinungen, Kulturen, Sprachen umzugehen, ist mein tägliches Geschäft. Ich bin schon sehr lange der Überzeugung, dass wir, wenn wir es als Institution nicht schaffen, unsere Diversität auf eine humane Art zu orchestrieren, den Nutzen, diesen unglaublichen Reichtum dieser Diversität nicht fruchtbar machen können. Es geht mir darum, diese vielfältigen Menschen, diese vielfältigen Zugänge, Positionen, Perspektiven so in Dialog zu setzen, dass etwas Tolles daraus entsteht. Ich habe da übrigens eine ganz schöne Erfahrung gemacht. Bei der letzten Departementskonferenz signalisierten ein paar Kolleg*innen an einem Workshop, dass sie die HKB als eine Art gesellschaftlicher Utopie empfänden und sie gerne entsprechend weiterentwickeln würden. Ich finde das Wort «Utopie» vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber dass wir versuchen, in dem Konstrukt einer Kunsthochschule manche Dinge vielleicht besser zu gestalten als ausserhalb dieser Institution, ohne gleich einen geschützten Raum um jeden Preis aus ihr machen zu wollen, finde ich eine wunderbare Idee, und dieser fühle ich mich auch verpflichtet.
AR: Ich komme noch einmal auf die Studierenden zurück. Wie können wir unsere Studierenden besser empowern? Ich sehe das als sehr wichtigen und herausfordernden Task, den man von Fall zu Fall anschauen und mit einer gewissen Empathie ernstnehmen muss. Ich möchte sie ermutigen, Diskriminierung anzusprechen,. Denn das braucht Mut und es sind teilweise auch unangenehme Themen und es geht einem nahe. Sie zu bestärken, indem wir ihnen zuhören und fähig sind, sie zu beraten oder sie weiterzuleiten an entsprechende Beratungsstellen, sehe ich als wichtige Aufgabe für mich als Lehrperson. Es sollten nicht die Studierenden sein, die mich instruieren und zur beratenden Instanz werden, sondern ich muss sensibilisiert sein.
TB: Didaktik und Beratung sind das eine, Vorbilder das andere. Wir brauchen Persönlichkeiten, die an der HKB in verschiedensten Rollen mit den Studierenden in Dialog kommen, ob als Führungspersonen oder vor allem als Lehrende, die diesen Diskurs auch glaubhaft verkörpern und praktizieren können. Damit man als Studierende*r mit einem*r Mentor*in eine enge dialogische Beziehung aufbauen kann, braucht es dort die richtigen Personen. Dass man deshalb Personen mit einem interessanten Background, mit einem unverwechselbaren Profil und der entsprechenden Erfahrung an die Hochschule holt, um fruchtbare Dialoge in Gang zu setzen, scheint mir zentral zu sein.
EG: Was ich von euch höre, ist: Diskriminierung erkennen, ansprechen und vorbildlich damit umgehen. Das passiert einerseits auf einer individuellen Ebene, da sehe ich aber auch die institutionelle Ebene, die dort vorbildlich sein kann. «Null-Diskriminierung» oder «Null-Konflikt» lässt sich nicht erreichen. Das gibt es nur, wenn man Diskriminierung ignoriert. Wir müssen ein Ort sein, wo ganz viele Leute daran arbeiten, mit Diskriminierung umzugehen, und zwar in einer Form, die Beziehungen wieder heilt und Leute unterstützt in Momenten, wo sie geschwächt oder verletzt werden. Wir müssen uns darum bemühen, zu erkennen, wo wir das nicht sind. Und dort, wo wir das nicht sind, müssen wir schauen, wie wir es werden können. Dazu gehört, dass man Hintergrundwissen zu Diskriminierung vermittelt, dass man aber auch miteinander einübt, wie man im Falle von Grenzüberschreitungen vorgeht. Annie, du hast vorhin gesagt, dass du die Anforderung an dich selbst hast, dass du genug darüber weisst, damit die Studierenden nicht in die Beratungsfunktion geraten müssen. Ich stimme dir dort in vielen Punkten zu, gleichzeitig weiss ich aber auch, dass vieles sehr individuell ist. Es gibt allgemeine Informationen, die man haben sollte, trotzdem gibt es sehr viele Einzelfälle. Es wird immer Situationen geben, wo ich mir sagen lassen muss, das war jetzt diskriminierend, und wo diese Person recht hat. Das heisst nicht, dass ich meinen Job nicht gemacht habe, sondern dass ich unter Umständen etwas nicht auf dem Schirm hatte, von dort aus aber weitergehe und weiterlerne. Das hat auch mit der Fehlerkultur zu tun, die am Anfang angesprochen wurde.
AR: Ich sehe das auch so. Ich wollte damit eher sagen, dass eine Person, die von Rassismus betroffen ist und ihren Fall an uns heranträgt, das nicht mit mir erarbeitet und sie nicht mich aufklärt, sondern dass ich die Empathie oder das Verständnis bereits habe und weiss, wie ich reagieren und sie unterstützen kann, damit ich beraten und in diesem Moment vielleicht sogar eine Vertrauensdozentin sein kann. Ich erhoffe mir, dass Studierende richtig begleitet werden und sie nicht die Dozierenden beraten müssen, was genau Rassismus ist und was nicht.
EG: Oder dass ich den häufigsten zehn Fettnäpfchen ausweichen und dann ins elfte treten kann. Und vielleicht auch, dass ich meine eigenen Grenzen kenne und jemandem auch sagen kann, dass ich zu einem bestimmten Thema nicht kompetent bin, und diese Person aus diesem Grund an die richtige Stelle weiterleite.
AR: Ich muss die Beratungsstellen kennen, damit ich weiss, welche Person ich wohin weiterleiten kann, wenn mein Kompetenzbereich das nicht abdeckt.
TB: Nicht zuletzt ist das alles auch eine Frage des Respekts. Ich finde, Respekt ist einfach zentral. Respekt vor der Individualität der Person, die mir gegenübersteht, mit all ihren Erlebnissen und Traumata. Ich halte es für zentral, dass wir gerade als Kunsthochschule, die ja Individualität ausbildet, diese Personen ernstnehmen und sie respektvoll behandeln und ihnen das Netz geben, welches wiederum Sicherheit bedeutet, dass es Personen oder Institutionen gibt, an die man sich wenden kann, dass es Spaces gibt, ob safe oder wie auch immer, wo wir dafür sorgen, dass die Sicherheit da ist, dass man sich öffnen kann, ohne diskriminiert zu werden.
EG: Dort aber auch zu sagen, es gibt Spaces, wo wir das nicht garantieren.
TB: Ja, für eine lebendige Diskurskultur braucht es sozusagen Safe Spaces und Fight Spaces.
AR: Einander mit Respekt und auf Augenhöhe begegnen, Machtgefälle erkennen, benennen. Viele von den 10 Prozent PoC an der HKB haben den Mut, auf uns zuzukommen. Mir ist es wichtig, dass wir sensibilisieren oder Aufklärungsarbeit leisten können, wenn wir feststellen, dass an einem Ort ein Machtgefälle entstanden ist. Was ist vorgefallen? Was kann ich unternehmen, damit die Studierenden wieder geschützt sind und diese Sicherheit wieder gewährleistet ist? Wir müssen auch die Frage, wie wir einander Respekt entgegenbringen, zu einem zentralen Gegenstand machen.
EG: Als Institution proaktiver damit umzugehen und die Prozesse einzuüben und zu entwickeln, ist eine Aufgabe, welche jetzt gerade sehr aktuell ist, die von der HKB-Leitung stark ernstgenommen wird, die wir aber noch nicht gut genug machen. Es ist eine wichtige Aufgabe, in der wir besser werden und uns kontinuierlich entwickeln müssen.
TB: Die HKB besteht aus 579 festangestellten Personen, dazu kommen noch Lehrbeauftragte und 1200 Studierende. Das heisst, die HKB besteht aus fast 2000 Einzelpersonen. Ich glaube, es wird nie ohne Konflikte und auch nie ganz ohne Situationen gehen, die als diskriminierend empfunden werden können. Wir müssen einfach alles dafür tun, dass wir diese Individualitäten und diese vielen Menschen dazu bringen, sich zu einem respektvollen Umgang miteinander zu committen. Wir sind auf einem Weg, wir sind noch weit weg von einem Idealzustand und ich glaube, es wird uns nie gelingen, einen vollkommen diskriminierungsfreien Raum an der HKB zu schaffen, aber wir machen grosse Fortschritte auf dem Weg zu einer gemeinsamen Kultur der Verständigung darüber, dass Respekt die Grundlage des gemeinsamen Miteinanders ist.
